2024-02-23: Schwangerschaft und HIV – Auch heute noch erleben Mütter mit HIV Diskriminierung bei der Entbindung
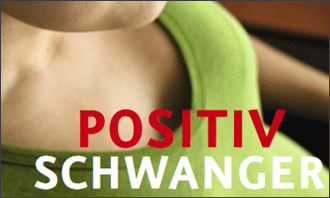 Dank des medizinischen Fortschritts ist es heutzutage für Menschen mit HIV, die sich Kinder wünschen, in vielen Fällen möglich, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. HIV-positive Frauen können auf natürlichem Weg schwanger werden, ihr Kind zur Welt bringen, es stillen und Mütter sein – wie andere auch. Dennoch werden den HIV-positiven Frauen oft Hindernisse in den Weg gelegt, sie erleben Diskriminierung oder ihre Wünsche zur Geburtsplanung werden ignoriert. So hat es auch Elke, Mutter von zwei Kindern, erlebt.
Dank des medizinischen Fortschritts ist es heutzutage für Menschen mit HIV, die sich Kinder wünschen, in vielen Fällen möglich, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. HIV-positive Frauen können auf natürlichem Weg schwanger werden, ihr Kind zur Welt bringen, es stillen und Mütter sein – wie andere auch. Dennoch werden den HIV-positiven Frauen oft Hindernisse in den Weg gelegt, sie erleben Diskriminierung oder ihre Wünsche zur Geburtsplanung werden ignoriert. So hat es auch Elke, Mutter von zwei Kindern, erlebt.
Elke weiß seit 2010, dass sie HIV-positiv ist. Sie beendete damals nach der Diagnose die Beziehung zu ihrem langjährigen Partner, da er sie betrogen hatte, und kehrte aus dem Ausland nach Deutschland zurück. Bald lernte sie durch gemeinsame Freunde ihren heutigen Mann kennen. "Eigentlich war eine Beziehung damals für mich kein Thema", erinnert sie sich. Sie war mit sich selbst beschäftigt, musste mit ihrer neuen Lebenssituation klarkommen. "Mein Mann und ich hatten zuerst eine Fernbeziehung. Bei unserem ersten richtigen Date habe ich ihm gesagt, dass ich HIV-positiv bin. Ich hatte ganz schön Muffensausen", sagt Elke. Rückblickend kann sie darüber lachen, denn er hatte sich schon informiert, war sogar bei einer Aidshilfe zur Beratung gewesen. "Vielleicht war mein HIV-Status einfach offensichtlich, weil ich noch so durcheinander war", sagt Elke. "Mein Mann hat mich danach immer unterstützt."
"Ich hatte das große Glück, dass mich HIV zunächst kaum beeinträchtigt hat. Ich ging, wie heute auch, alle drei Monate zur Kontrolle, meine Werte waren gut", erklärt Elke. Wegen der guten Werte unter regelmäßiger Kontrolle waren Medikamente lange kein Thema für sie. "Heute lautet die Empfehlung aber, sofort mit der medikamentösen Therapie zu beginnen. Ich denke, das ist auch sinnvoll", erklärt Elke. Sie und ihr Mann wünschten sich irgendwann Kinder und sie startete aus diesem Grund die Therapie mit HIV-Medikamenten – sehr erfolgreich: "Schon nach einer Woche war meine Viruslast unter der Nachweisgrenze – und wenig später war ich auch schon schwanger."
Bis dahin eine schöne Erfahrung, doch ihre Schwangerschaft war für Elke auch mit Diskriminierungserfahrungen verbunden: der obligatorische HIV-Test zum Beispiel, obwohl ja schon bekannt war, dass sie HIV-positiv ist. Die darauf folgende Meldung an das Robert-Koch-Institut, das dann wiederum Fragen stellte. Der mehrfache Eintrag des HIV-Status in den Mutterpass, sodass er für jeden direkt offensichtlich war... Diese Reihe lässt sich fortsetzen. "Heute bin ich als Buddy tätig und berate oft auch schwangere HIV-positive Frauen. Daher weiß ich jetzt, dass man darauf bestehen kann, einen neuen Mutterpass ohne diesen Eintrag zu bekommen", sagt Elke. "Offenbar wird nicht darüber nachgedacht, was ein solcher Eintrag für HIV-positive Schwangere bedeutet. Ich habe manchmal das Gefühl, die im medizinischen Bereich Tätigen reflektieren in dieser Hinsicht zu wenig."
Eine Entbindung an ihrem eher ländlich gelegenen Wohnort war nicht möglich, zudem wird HIV-positiven Frauen empfohlen, ihr Kind in einem sogenannten Level-1-Krankenhaus – das über ein Perinatalzentrum mit der höchstmöglichen Versorgungsstufe für Früh- und Neugeborene verfügt – auf die Welt zu bringen. "Das fand ich auch in Ordnung, ebenso die engmaschigere Betreuung und die häufigeren Ultraschall-Termine während der Schwangerschaft. Es war eigentlich ganz schön, öfter zu sehen, dass sich unsere Tochter gut entwickelt", erklärt Elke rückblickend. Vor Ort betreute sie ihre Gynäkologin, auch in der Entbindungsklinik gab es Untersuchungen und Vorgespräche. "Es war immer wahrscheinlich, dass ein Kaiserschnitt auf uns zukommen könnte. Bei der ersten Schwangerschaft hatte das auch damit zu tun, dass unsere Tochter in Beckenendlage war. Ich glaube aber aus heutiger Sicht, dass ohnehin allen Seiten ein Kaiserschnitt lieber war, als eine natürliche Geburt." Sie hinterfragte nicht, was geplant wurde, der Termin für den Kaiserschnitt wurde zwei Wochen vor den errechneten Geburtstermin gelegt.
Bei der Geburt musste sie erneut Diskriminierung erfahren: "Als ich im Kreißsaal lag und auf die Geburt vorbereitet wurde, hat mich jemand nach meiner HIV-Infektion gefragt, darüber, wie ich mich denn angesteckt hätte. Als ob das ein Thema für Smalltalk wäre. Ich habe mich aber nicht getraut, etwas zu sagen oder mich darüber aufzuregen. Man fühlt sich ja ohnehin völlig ausgeliefert in dieser Situation", berichtet sie. Ihre Tochter kam gesund zur Welt, nach einigen Gesprächen bekam die Familie ein Familienzimmer, die üblichen Überwachungen und Prophylaxe-Maßnahmen für das Baby verliefen ohne Probleme.
Ganz anders erging es Elke bei ihrer zweiten Schwangerschaft einige Jahre später, denn die fiel zeitlich mitten in die Corona-Pandemie mit ihren Kontaktbeschränkungen, eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten und einer allseits großen Angst. Auf Empfehlung einer Ärztin hatten sich Elke und ihr Mann diesmal für eine andere Entbindungsklinik entschieden. Auch diesmal gab es die üblichen Vorgespräche: "Ich habe sehr deutlich gesagt, dass es mir am Wichtigsten ist, dass mein Sohn nach der Geburt bei mir ist", betont Elke. Ein Familienzimmer würde es wegen Corona nicht geben, doch ihr Baby sollte ihre Nähe spüren. Alles war besprochen, auch diesmal sollte es ein Kaiserschnitt werden, obwohl sich Elke eigentlich erhofft hatte, dass sie spontan gebären würde. Doch ihr Wunsch wurde eher kritisch gesehen, weil der errechnete Geburtstermin erreicht war und die Wehen noch nicht eingesetzt hatten. So kam es erneut zum geplanten Termin im Kreißsaal, bei dem sich die Diskriminierungserfahrung von der ersten Geburt wiederholte, wie in einem schlechten Film: "Ich wurde wieder auf meine HIV-Infektion angesprochen, als ich für die Geburt vorbereitet wurde. Man kann es kaum glauben."
Doch das sollte noch nicht das Schlimmste sein. "Sie haben mir nach der Geburt das Kind weggenommen", sagt Elke und ist noch jetzt spürbar entsetzt, wenn sie an die Situation zurückdenkt. Plötzlich musste das Neugeborene angeblich unbedingt auf die Kinderstation, zum Monitoring und um die Prophylaxe zu bekommen. Der leitende Kinderarzt war für ein klärendes Gespräch nicht erreichbar. "Warum sollte man ein Kind von seiner Mutter trennen, wenn es gesund ist?" Elke und ihr Mann haben den Verdacht, dass es um Geld gegangen sein könnte, da das Krankenhaus diese Art von Versorgung für ein Baby anders abrechnen kann. "Die HIV-Prophylaxe kann man auch selbst machen, das ist ein Saft, der oral verabreicht wird. Oder die Mediziner hätten das Kind dafür aus dem Zimmer kurz abholen können", sagt Elke. Stattdessen verbrachte sie die erste Nacht nach der Geburt komplett allein: Ihr Baby war weg, ihr Mann durfte wegen Corona immer nur kurz am Tag bei ihr sein. „Ich vermute, dass ich wegen HIV ein Einzelzimmer bekommen habe, und da lag ich dann unter starken Schmerzmitteln und ohne Kind.“ Die Familie machte enormen Druck, Elkes Mann informierte sich bei allen möglichen Stellen vom Anwalt bis zum Jugendamt. "Ich hatte auch Kontakt mit Dr. Annette Haberl, die unter anderem zu HIV und Stillen forscht, sowie mit Kerstin Mörsch von der Antidiskriminierungsstelle der Deutschen Aidshilfe. Viele haben uns unterstützt darin, das Richtige zu tun, indem wir einforderten, dass das Kind bei mir ist." Auch eine Stillberaterin in der Klinik machte deutlich, dass sie die Situation sehr kritisch sieht, und bestärkte Elke – auch mit Blick auf zukünftige Mütter, die in diese Situation geraten könnten. Am Ende gab die Klinik dem Druck der Familie nach: Am nächsten Tag kam das Baby endlich zu seiner Mutter aufs Zimmer. "Wir hatten uns sogar schon darauf vorbereitet, unseren Sohn zu nehmen und zu gehen, obwohl das bei den medizinischen Umständen mit Kaiserschnitt schwierig gewesen wäre."
Anderthalb Tage hatte Elke ihr Baby am Ende nicht bei sich, konnte die so wichtige Verbindung zwischen Mutter und Kind erst mit Verspätung aufbauen. "Wir haben nie eine Entschuldigung vom Krankenhaus bekommen. Auch nicht, als ich später noch mal mit meinem Sohn zu einem Kontrolltermin dort war. Der Arzt hat alles abgeblockt, wollte nicht darüber reden." Seither legt Elke jedes Jahr am Roses Revolution Day im November eine Rose vor dem Kreißsaal ab, um daran zu erinnern, dass sie bei der Geburt Gewalt erfahren hat.
Ihre eigenen Erfahrungen haben Elke darin bestärkt, sie anderen Frauen ersparen zu wollen. Wird sie von einer HIV-positiven Schwangeren als Buddy kontaktiert, versucht sie, die Frauen bestmöglich für das zu rüsten, was an Diskriminierung kommen könnte, und unterstützt sie dabei, ihre Wünsche klar zu äußern. "Ich möchte die Frauen kompetent machen, sie mit Wissen versorgen und sie ermutigen, sich ein Netzwerk zu schaffen und sich gegenseitig zu unterstützen."
Eine wichtige Informationsquelle sind die Deutsch-Österreichischen Leitlinien. "Momentan warten wir alle ein bisschen auf die neuen Leitlinien der DAIG. Eigentlich kommen da etwa alle drei Jahre neue, weil sich in der Forschung viel tut, zum Beispiel beim Thema Stillen." Zum Stillen gibt es bislang noch wenige Forschungsergebnisse, doch eigentlich gilt schon jetzt, dass unter bestimmten Bedingungen (wie einer erfolgreichen antiretroviralen Therapie) auch HIV-positive Mütter stillen können. "Dennoch wird es den Frauen immer noch oft ausgeredet. Das finde ich unmöglich."
Wie könnte es besser laufen beim Thema HIV und Schwangerschaft? Elke sagt: "Das medizinische Personal müsste besser geschult sein. Einerseits was den neuesten Stand der Forschung bei HIV angeht, andererseits aber auch zum sensiblen Umgang mit HIV-positiven Schwangeren. Die Leitlinien sollten bekannt sein, der Eintrag von HIV im Mutterpass wegfallen. Und die Geburt muss mit den werdenden Müttern auf Augenhöhe geplant werden, ihre Wünsche müssen gehört und anerkannt werden. Klar kann es immer anders kommen, als es geplant war. Aber über die Köpfe der Mütter hinweg Entscheidungen zu fällen oder ihnen keine Wahl zu lassen, ist nicht in Ordnung."
Hintergrundinfo:
Auszüge aus den aktuellen Leitlinien (Stand September 2020, weitere Infos unter daignet.de):
- Jede Schwangere mit HIV-Infektion soll eine antiretrovirale Therapie erhalten.
- Bei einer HIV-RNA <50 Kopien/ml vier Wochen vor und bis zur Entbindung kann eine vaginale Entbindung erfolgen, wenn die Schwangere eine ART einnimmt und keine anderen geburtshilflichen Risiken bestehen.
- Bei supprimierter mütterlicher VL (<50 Kopien/ml) soll die Entscheidung über das Stillen unter Abwägung von Nutzen und Risiken in einem partizipativen Prozess getroffen werden.
- Wenn bereits vor der Schwangerschaft eine erfolgreiche ART bestand und die HIV-RNA während der gesamten Schwangerschaft und zeitnah vor der Geburt immer <50 Kopien/ml lag, kann auf eine postnatale Expositionsprophylaxe verzichtet werden.
Termine
Hier finden sie alle Termine und Aktivitäten der nächsten Wochen